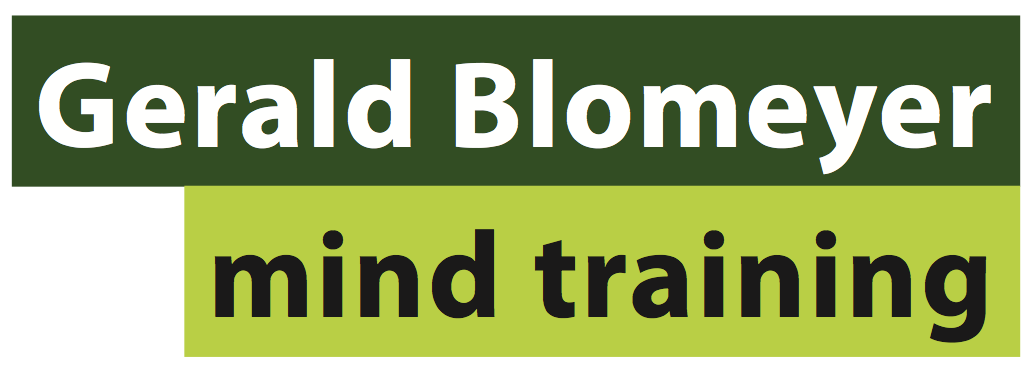„Ohne Verletzlichkeit, keine Kreativität. Ohne Toleranz für Scheitern, keine Innovation. So einfach ist das … Wenn du nicht bereit bist zu scheitern, kannst du nicht innovieren. Wenn du nicht bereit bist, eine Kultur der Verletzlichkeit aufzubauen, kannst du nichts erschaffen.“ UND
„Das wahre Hindernis für mutige Führung ist, wie wir auf unsere Angst reagieren.“
– Brené Brown, amerikanische Sozial-Forscherin auf dem Gebiet von Scham, Verletzlichkeit, Mut und Selbstwertgefühl.
„Der Prozess bedeutet wachsende Offenheit für Erfahrung – das Gegenteil von Abwehr. Abwehr entsteht, wenn Erlebnisse das eigene Selbstbild bedrohen; sie werden verzerrt oder verdrängt, um ungefährlich zu wirken. So bleibt mir verborgen, was nicht zu meinem Bild von mir selbst passt.“
– Carl R. Rogers (1902–1987)
Wenn wir uns getrennt fühlen
Fühle ich mich getrennt – von einem Gefühl, das ich nicht haben will, oder von einer Situation, die ich mir anders wünsche –, entsteht in mir Unruhe. Ein lauter Kritiker meldet sich zu Wort. Er zweifelt, warnt, macht mir Angst. Diese Stimme kennt nur Sicherheit, Kontrolle, Rückzug. Doch daneben gibt es noch eine andere: eine leise, feine Stimme – meine Intuition. Sie spricht nicht in Worten, sondern in Empfindungen. Manchmal pocht sie in meinem Herzen, manchmal zieht sie in meinem Bauch, manchmal ist sie nur ein stilles Wissen, das plötzlich da ist. Dieses Hinsehen braucht Mut. Es macht mich verletzlich. Doch genau in dieser Verletzlichkeit liegt meine Stärke. Denn wenn ich der leisen Stimme Raum gebe, wird mein Ego still. Denken und Fühlen finden zueinander.
Wenn ich meine volle Kraft entfalten will, muss ich dieser sanften Stimme wieder Raum geben. Sie kennt meinen Weg. Sie weiß, was wahr ist. Sie führt mich nicht durch Angst, sondern durch Klarheit. Und es beginnt immer mit dem Annehmen dessen, was gerade ist. Alles, was ich wegdrücke, schafft Spannung. Wenn ich es weiter verdränge, wird daraus Schmerz – und irgendwann Angst. Doch in dem Moment, in dem ich mich traue, hinzusehen – wirklich hinzusehen –, beginnt sich der Druck zu lösen. Der Schmerz darf gehen, das Ego wird still. Denken und Fühlen finden zueinander. Und aus diesem Einklang wächst etwas Neues, etwas Verletzliches: eine stille, klare Kraft.
Männer sind lieber „überfordert“ als „krank“
Wenn ein Mann zusammenbricht, sagt er meist nicht „Depression“ – er sagt „Burnout“. Denn das klingt nach Leistung, nicht nach Schwäche. Nach zu viel Einsatz, nicht nach zu wenig Halt. Der Begriff entstigmatisiert, was in Wahrheit oft eine Depression ist. „Man hat sich selbst überfordert, war beruflich zu ehrgeizig“, sagt Psychiater Ulrich Hegerl – „das klingt besser als ‚Depression‘.“ Und in einer Gesellschaft, die Leistung feiert und Verletzlichkeit misstraut, ist das entscheidend.
Doch Männer warten meist, bis der Schmerz unerträglich wird. Bis der Körper aufgibt, die Gedanken erstarren, die Welt sich schließt. Dabei sterben in Deutschland jedes Jahr rund 10.000 Menschen durch Suizid – drei Viertel davon sind Männer.
„Suizide haben oft mit unbehandelten Depressionen zu tun“, sagt Psychologe Björn Süfke. Trauer, Angst, Hilflosigkeit – das passt nicht ins traditionelle Männerbild. Der „echte“ Mann hält durch. Klagt nicht. Zeigt nichts. Wer nie gelernt hat, mit solchen Gefühlen umzugehen, steht plötzlich hilflos da – und greift nach dem einzigen Etikett, das nicht beschämt: Burnout. Doch wahre Stärke beginnt dort, wo das Schweigen endet. Nicht der, der durchhält, ist stark – sondern der, der sagt: „Ich brauche Hilfe.“
Ohne Scham. Endlich.
Alles willkommen heißen
Lieben bedeutet, den Mut zu haben, alles willkommen zu heißen – auch das Unbequeme, das Unklare, das Unperfekte. Es bedeutet, uns selbst nicht länger auszuschließen. Verletzlichkeit ist kein Zeichen von Schwäche – sie ist der Eingang zu echter Verbindung. Mit uns. Mit anderen. Mit dem Leben.
Wenn etwas in uns auftaucht – ein Gefühl, ein Gedanke, eine Erinnerung oder eine körperliche Reaktion – dann nicht, um uns zu stören, sondern um uns etwas zu zeigen. Diese inneren Regungen sind keine Gegner. Sie sind Boten. Und wenn wir still werden, hinhören und fragen: „Was willst du mir sagen?“, dann beginnen wir, mit dem Leben zu fließen, statt uns zu verschließen. Es geht nicht darum, alles zu kontrollieren, sondern dem Leben zu begegnen mit: „Ich sehe dich. Ich bin bereit.“ In dieser Haltung der Offenheit – der radikalen Annahme – liegt unsere Kraft. Denn erst, wenn wir aufhören zu kämpfen, können wir wirklich antworten – aus dem Herzen heraus.
In der Meditation üben wir genau das: allem zu begegnen, was auftaucht. Es zu begrüßen, bei ihm zu bleiben – und in Verbindung zu treten. Diese Praxis ist eine Kunst. Eine psychologische, ja spirituelle Kunst, mit der wir lernen, mit unserer ganzen inneren Welt zu arbeiten: mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Schmerz, Krankheit, der Psyche – und mit dem Körper selbst.
Nachspüren
Wann hast du zuletzt innerlich gespürt, dass du dich von einem Gefühl oder einer Situation trennst – und was kannst du jetzt über diese Erfahrung lernen?
Wie könntest du dir selbst liebevoll begegnen, wenn du das nächste Mal spürst, dass etwas nicht stimmt?
Podcast-Meditation Alles willkommen heißen
Gerald Blomeyer, Berlin am 12. Oktober 2025
Foto: (c) Tom Pingel Buchvorstellung Berlin am 30. September 2025
Der Text wurde angeregt von einem Beitrag der Tagesschau zu Verletzlichkeit
Brené Brown on How to Lead With Vulnerability at Work | The Interview